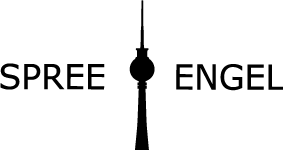Die Gastronomie steckt in einer Krise. Das können wir nicht nur immer wieder in den Nachrichten lesen, sondern werden auch tagtäglich Zeuge davon.
Bei einem Spaziergang durch den Kiez entdeckt man ein leeres Ladenlokal, wo vor zwei Wochen noch ein Café gewesen ist und auf meiner Google-Liste mit Restaurants, die ich noch besuchen möchte, erscheint immer öfter in roten Buchstaben „Dauerhaft geschlossen“.
Die Gründe für die gastronomische Ausdünnung sind vielfach, von höheren Kosten über Personalmangel bis hin zum veränderten Ausgehverhalten der Gäste. Diese Gründe werden bereits zahlreich diskutiert. Was mich viel mehr interessiert, was sind die Gründe, die den Unterschied machen?! Denn auch in der aktuell schwierigen Phase gibt es noch Betriebe, die erfolgreich funktionieren. Was machen diese Betriebe anders? Und ich rede hier nicht von Konzepten, die mit schlechter Qualität und Preisdumping arbeiten! Sondern von denen, die trotz Qualitätsanspruch und entsprechenden Preisen erfolgreich sind.
Auf der Suche nach den möglichen Ursachen, kommt mir ein Satz in den Kopf, den mir Kevin Fehling bereits vor mehr als 6 Jahren genannt hat, „Das wichtigste ist, dass man eine Geschichte erzählt.“ Kevin Fehling betreibt mittlerweile seit 10 Jahren in Hamburg das „The Table“, das direkt im ersten Jahr mit 3-Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Er ist damit einer der wenigen Köche, der ein 3-Sterne-Restaurant selbstständig ohne Hotel oder Hauptsponsor im Rücken leitet. Wenn einer weiß, wie man erfolgreich ein Restaurant führt, dann wohl er.
Doch was steckt hinter diesem Satz? Wie beherzigt er ihn? Ist er wirklich der Schlüssel?
Fehlings Restaurant heißt nicht nur „The Table“, sondern es besteht aus einem Tisch, an dem alle Gäste bei ihrem Besuch Platz nehmen um einen Abend mit Blick in die Küche zu genießen. Also schon einmal ein guter Prolog in den Abend. Doch er spielt die Geschichte mit seinen Speisen weiter.
Bevor er sich selbstständig gemacht hat, ist er in verschiedenen Küchen herumgekommen unter anderem hat er zwei Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff Europa gearbeitet und so verschiedene kulinarische Kulturen kennengelernt. Diese Einflüsse finden ihren Weg auf seinen Teller. Gleichzeitig hat er auch eine klare Tellersprache entwickelt, die seine Teller unter denen anderer Köche deutlich erkennbar macht. So führt er seine Gäste an einem Abend in seinem Restaurant durch die abwechslungsreiche Geschichte seiner Erfahrungen ohne jedoch den roten Faden zu verlieren. Und ist es nicht das, was wir an einem guten Buch lieben? Nur logisch, dass dies auch in anderen Bereichen funktioniert.


Doch ist dieser Weg auch abseits einer 3-Sterne-Küche möglich? Und was können Gastronomen daraus lernen?
Menschen lieben Geschichten. Auch wenn heutzutage das Lesen von Büchern weniger geworden ist, hat sich daran nichts verändert. Nur die Art, wie Geschichten erzählt werden hat sich verändert. Das beste Beispiel hierfür sind Influencer. Sie wären nicht erfolgreich, wenn sie nicht von ihren Erfahrungen, Wünschen und Interessen berichten würden.
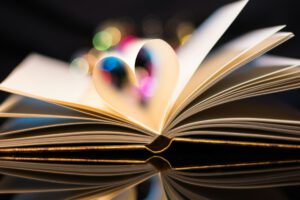
Niemand würde ihre beworbenen Produkte kaufen, wenn sie nur in die Kamera gehalten werden. Sie beeinflussen und überzeugen Menschen dadurch, dass sie eine Geschichte über sich oder ihr Leben erzählen. Ob diese wahr ist oder nicht, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Auch Märchen waren schließlich immer schon ein erfolgreiches Genre.
Einige Köche haben diese Art des Storytellings bereits als Erfolgsmodell erkannt und leben es. Entweder über Social Media, über Fernsehauftritte oder Bücher, die Möglichkeiten sind heute zahlreich.
Allen voran sind hier sicher die Fernsehköche zu nennen, prominenteste Beispiele sind Steffen Henssler oder Tim Mälzer.
Ohne seine Fernsehauftritte hätte ein Alfons Schubeck damals niemals glaubhaft einen Gewürzladen eröffnen oder Bücher über Gewürze verkaufen können.
Ein Max Strohe aus dem Berliner „Tulus Lotrek“ versucht durch seine Bücher und seit neustem die Fotografie Einblicke in die Geschichte seines Lebens zu liefern.
Egal, welche Medien genutzt werden, ist allen gemein, dass sie neben dem monetären Effekt, den der Verkauf von Büchern und Küchenprodukten oder die Gagen von Fernsehsendungen bringen zum Einen ihre Restaurants unterstützen können, zum Anderen aber auch überhaupt erstmal darauf aufmerksam machen.
Doch was machen Köche, die nicht im Rampenlicht stehen wollen? Haben die keine Geschichte zu erzählen?
Einmal noch ergänzt, stellt sicher nicht jeder in den Medien sein Leben zur Schau, nur weil er dort vertreten ist. Tim Mälzer hält sein Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit und ist bei weitem nicht so ein Prolet, wie er manches Mal erscheint. Aber er hat eine Rolle für die Öffentlichkeit erschaffen, die erfolgreich eine Geschichte erzählt, sich weiterentwickelt und zu der sein Restaurant „Die Bullerei“ in Hamburg passt.


Doch es gibt Köche, die lieber authentisch sind und keine Neigung dazu haben, im Scheinwerferlicht zu stehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie in der heutigen Zeit nicht erfolgreich sein können. Doch statt eine Geschichte über sich zu erzählen, müssen sie es schaffen, dass ihr Konzept diese Aufgabe für sie übernimmt.
Beispiele hierfür sind das „Nobelhart und Schmutzig“ in Berlin, das „100/200“ in Hamburg oder das „Seven Swans“ in Frankfurt.
Extreme Regionalität, Saisonalität, Nose to Tail oder vegan Küche prägen diese Konzepte. Diese Spezialisierung wird medial nach außen getragen, doch vor allem wird der Gast bei seinem Besuch durch diese Restaurantgeschichte geleitet. Kleine Karten mit den Produzenten der dargebotenen Speisen, Geschichten zu den Produkten oder Erklärungen zu Herstellungsarten, vielleicht gespickt mit Anekdoten zu der Lieferantensuche oder missglückten ersten Herstellungsversuchen, die Möglichkeiten des Storytellings sind auch hier kaum begrenzt und holen den Gast auf eine etwas sanftere Art ab, als es die Präsentation durchs Rampenlicht tut.
Emotionen machen den Unterschied
Egal für welche Art des Geschichten erzählens sich der Gastronom entscheidet, haben alle gemein, dass Emotionen geweckt und dadurch Vertrautheit geschaffen werden. Und das ist es, was letztlich den Unterschied ausmacht.
Das Angebot an verschiedenster Art von Gastronomie ist trotz aller Schwierigkeiten enorm. Schließt ein Restaurant, öffnet oft nach kurzer Zeit ein Neues an diesem Standort seine Türen.

Was fehlt ist die Beständigkeit, nicht die Vielfalt. Doch um sich langfristig zu halten, genügt es eben nicht mehr „nur“ Essen anzubieten.
Man muss sich abheben, einen Unterschied machen und das funktioniert nur, in dem man Emotionen und Gefühle weckt. Die Gäste möchten sich wohl fühlen, vielleicht ein paar Stunden ihre eigenen Probleme vergessen und in eine fremde Geschichte eintauchen.
Wenn das gelingt, werden diese Menschen zu Stammgästen und empfehlen ihre Wohlfühlorte weiter, damit sie noch lange bestehen bleiben.
Und so wird aus der Geschichte über Koch oder Konzept eine Erfolgsgeschichte.